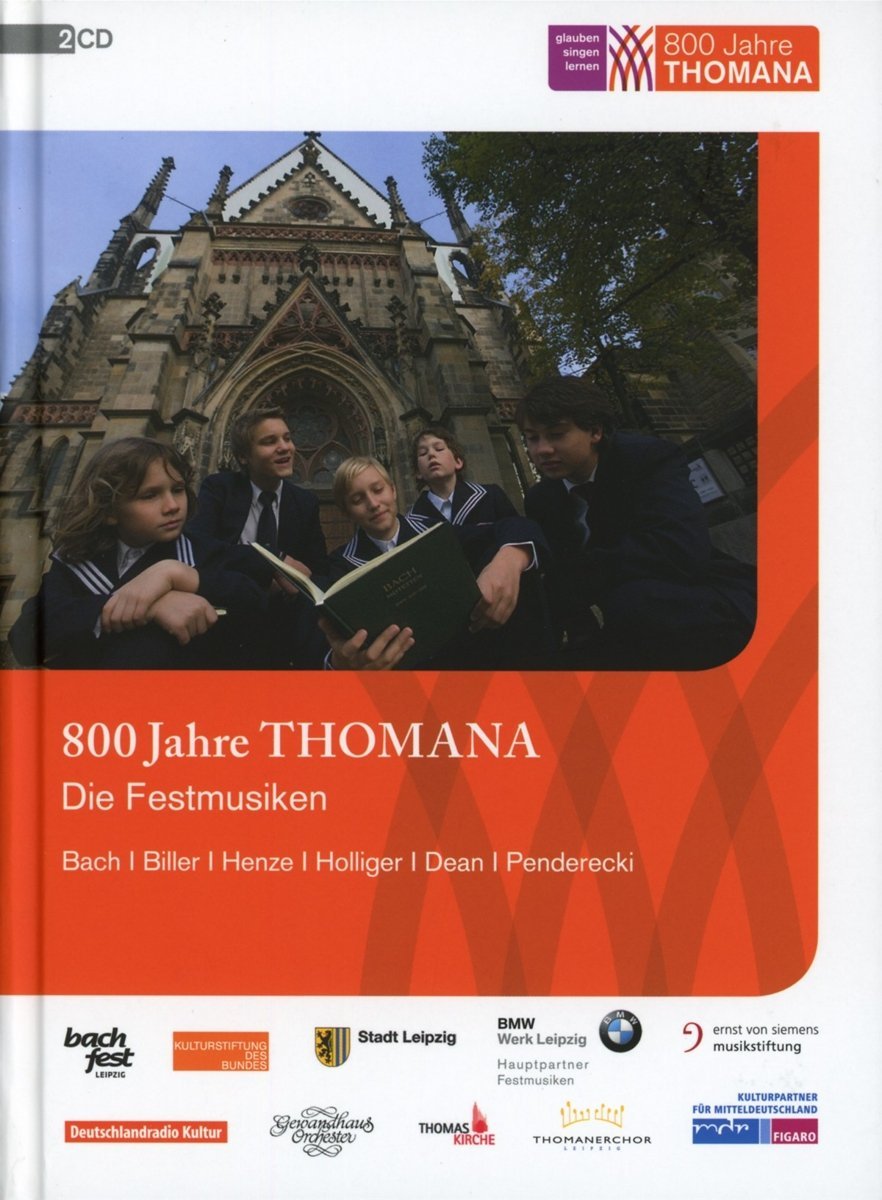Gedanken zu den 6 Festmusiken für 800 Jahre Thomana
Um es vorweg zu nehmen: Man kann dem Bach-Archiv Leipzig mit den Herren Prof. Dr. Christoph Wolff und Dr. Dettloff Schwertfeger für die Idee und Initiative, zum Thomaner-Jubiläum sechs Festmusiken in Auftrag zu geben und ihre Realisation durchzusetzen, nicht genug Respekt zollen. Die Komponisten Sofia Gubaidulina für Epiphanias, Georg Christoph Biller für Ostern, Hans Werner Henze für Pfingsten, Heinz Holliger für das Reformationsfest, Brett Dean für Weihnachten und Krzysztof Penderecki wieder für Epiphanias waren so ausgewählt, dass es musikalisch keine Dopplungen gab, sich die Komponistenpersönlichkeiten deutlich voneinander unterschieden.
Leider musste Sofia Gubaidulina krankheitshalber absagen, was ich besonders bedauerte; hatte ich sie doch noch zu DDR-Zeiten in Dresden als eine sensible hochintelligente Frau kennengelernt. Dafür erklang dann die 6. Kantate aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, der beste Auftakt aus der Tradition der Thomaner.
I.) Johann Sebastian Bach. Weihnachtsoratorium BWV 248 Teil 6 „Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben“ am 6. Januar 2012:
Thomaskantor Georg Christoph Biller eröffnet mit den Thomanern und dem Gewandhausorchester Leipzig glanzvoll in zügigem Tempo, dynamisch stark differenziert und in sehr ausgewogener Balance der Mitwirkenden und schließt ebenso überzeugend ab. Die Solisten Paul Bernewitz, Ingeborg Danz, Christoph Genz, Martin Petzold und Panajotis Iconomou überzeugen einzeln wie auch im Rezitativ-Quartett. Besonders phänomenal dabei die Leistung des Thomaners Paul Bernewitz, der den Erwachsenen stimmlich, in Sicherheit und Gestaltung nicht nachsteht, einfach wunderbar. Sehr eindrucksvoll die schlichte verinnerlichte Gestaltung des Paul-Gerhardt-Textes „Ich steh an deiner Krippen hier“.
II.) Georg Christoph Biller: „St.-Thomas-Ostermusik“ für Solostimmen, Chor, Bläser, Kontrabaß und Schlagwerk nach Texten aus dem Evangelium Matthäus, von Jürgen Henkys, Matthias Storck und aus dem 14. Jahrhundert,
8. und 21. April 2012:
Georg Christoph Biller, 1955 in Nebra geboren, seit 1992 Thomaskantor, setzt mit diesem eindrucksvollen Werk die Linie der komponierenden Thomaskantoren fort. Mit dem Septakkord vom Ende der Bachschen Matthäus-Passion beginnt es düster, mehrmals geschickt wiederholend, vorsichtig auflösend, allmählich Licht in das Dunkel bringend, wobei besonders Blockflöten eingesetzt werden. Ergänzt und durchsetzt wird das musikalische Geschehen durch zwei Chöräle in bewährter Billerscher Satzmanier, die die Gemeinde mitsingen soll, was bei dem bekannten „Christ ist erstanden“ noch einigermaßen gelingt, nicht so sehr beim 2. Choral „Wir sind die einzige Bibel“, weil das Blattsingen der Gemeinde hier nicht so gut funktioniert. Ein Problem der unkalkulierbaren Interpreten wie es nun mal eine Gemeinde darstellt.
Die Musiksprache ist zum Text ambitioniert, bezieht schlichte Klänge, archaische Melodik bis zur Clusterharmonik und dichten harmonischen Feldern ein. Ein würdiger Beitrag des amtierenden Thomaskantors. Der Thomanerchor und das Ensemble „amarcord“ überzeugen durch sichere Klang- und Textgestaltung.
III.) Hans Werner Henze: „An den Wind“, Musikstück zu Pfingsten für gemischten Chor und Instrumente nach Texten von Christian Lehnert,
26. und 27. Mai 2012.
Hans Werner Henze, 1926 in Gütersloh geboren, 2012 in Dresden verstorben, bekennt sich hier zu seiner Bach-Sicht, uns die Idee von einem vermenschlichten und veredelten Gott näher gebracht zu haben. Henze hat sich als Atheist (ich stand mit ihm zusammen am Grab von Paul Dessau) in den letzten 20 Jahren seines Lebens zunehmend mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt, wobei ihm hier die Texte des Theologen Christian Lehnert offenbar eine Richtschnur waren.
Von der Ratlosigkeit der 11 Jünger nach der Himmelfahrt („Gott ist weg“), die auch einzeln zu Wort kommen, spannt sich der Bogen zum Pfingstgeschehen nach dem Evangelisten Lukas mit den Bildern wie Feuer, Zungenreden, Asche und Feuerbad bis zum Symbol der Taube (Choral) als Bild des Heiligen Geistes, der Dämmerung einer neuen Welt, die noch verborgen ist („Gott wird immer noch mehr gesucht als gefunden“).
Die Musiksprache gestaltet aufscheinende Seufzer, setzt sowohl Unisono-Gesang, Sprechchor, berührende durchsichtige Klänge, repetierende Akkorde und scharfe Akzente sowie ein Zitat von „Jesu, meine Freude“ ein (die Bach-Motette erklang dann auch als Nachruf zu Henzes Tod kurz nach der Uraufführung seines Werkes in der Thomaskirche). Henze gestand, dass er selten so viel Freude bei einer Arbeit gehabt habe.
IV.) Heinz Holliger: „hölle himmel“, Motette für Chor a cappella und Schlagzeug ad lib. nach Gedichten von Kurt Marti, zum Reformationsfest,
3. November 2012.
Heinz Holliger, 1939 in Langenthal / Schweiz, Kanton Bern geboren, war unter anderem Schüler von Pierre Boulez und setzte sich als international gefeierter Oboist auch für Werke von Henze, Penderecki und Lutosławski ein. Er entwickelte eine besondere Neigung zu Künstlern am Rande der Gesellschaft und an der Grenze des Lebens. Seine Musik ist geprägt von der Suche nach den Grenzen von Musik und des Lebens. Sie will sich dem Publikum nicht anbiedern. Kirchenmusik sollte nach Holligers Ansicht kompromisslos auf viele Gedanken Christi aufmerksam machen und „den jungen Sängern immer noch aktuelle Gedanken zum Zustand unserer Welt ans Herz legen.“
Aber hier liegt wohl auch das Problem des Werkes, das sich zwar durch strukturelle Dichte und eindrucksvolle musikalische Substanz auszeichnet, aber in seiner vielfach punktuellen Anlage, seinen extremen Intervallfolgen, seinem häufigen Wechsel von Singen und Sprechen sowie den doch ziemlich vertrackten Rhythmen einfach die Leistungs- und Aufnahmefähigkeit selbst eines hervorragenden Kinder- bzw. Knabenchores übersteigt. Demzufolge musste die Uraufführung in die Hände eines professionellen Erwachsenen-Ensembles, dem „Ensemble vocal modern“ unter der Leitung von Christfried Brödel gelegt werden. Diese entledigen sich ihrer Aufgabe allerdings mit hervorragender Bravour, gesanglich wie sprachlich, klar, deutlich, aber auch mit hörbarer Emotionalität.
Es ist außer dem Werk von Brett Dean das wohl am weitesten in die Moderne ragende Werk. Dabei sind die Ausdeutungen einzelner Wörter wie „krieg“, „gewalt“ oder „erleuchtung“ nicht in jedem Falle nachvollziehbar, weil zu sehr auf den Wortsinn bezogen. Auch die Verbindung von „müllen“ (dem weltlichen Müllnotstand) und „Das Wandern ist des Müllers Lust“ will außer dem Wortbezug nicht unbedingt einleuchten, obwohl Holliger da musikalisch ein besonders stringender Teil gelingt. Mit dem oft gebrauchten Symbol des Windes steht die Aussage in einer merkwürdigen Kontrastbeziehung zu Henzes Werk „An den Wind“.
Für mich enthält Holligers Komposition mit ihrem Text zuviel rein weltliche Problematik, so dass es mehr in die Nähe eines weltlichen Oratoriums gerät und zudem mit seinem hoffnungslosen Schluß auch nicht gerade aufbauend wirkt. Das haben wir im wirklichen Leben zur Genüge. Eine Anbiederung geschieht allerdings damit wirklich nicht. In der „konzentrierten, teilnahmsvollen Hörergemeinde“ (Holliger) war eine gewisse Ratlosigkeit durchaus wahrnehmbar.
V.) Brett Dean: „The Anuncation“ (Die Verkündigung) für vier- bis zwölfstimmigen Chor und kleines Orchester nach Texten von Graeme Williams Ellis (dem auch die erste Überschrift entnommen ist), zu Weihnachten,
22. und 25. Dezember 2012.
Brett Dean wurde 1961 in Brisbane geboren, war 14 Jahre Bratscher bei den Berliner Philharmonikern und ist heute einer der am häufigsten aufgeführten Komponisten seiner Generation. Seine Inspirationen bezieht er aus Literatur, Politik, Umwelt oder visuellen Eindrücken, wobei Gemälde seiner Frau Heather Betts eine Rolle spielen. Brett Deans Werk, das die Finsternis und Dramatik des Weihnachtsgeschehens gestalten möchte, beginnt vor Weihnachten im trostlosen Reich des Todes, mit der hohlen Herrschaft der Reiche und den falschen Schatten des bisherigen Lebens mit dem Text aus 4. Mose 24,17. Folgerichtig ist die musikalische Gestaltung dunkel, tastend, fragend bis sie kraftvoller emphatisch und schließlich gleißend hell wird (Chorklang im 4. Satz „Anrufung Jesu“).
In der Orchestereinleitung wird bereits das Komponieren in Klangflächen deutlich, aus der sich der Chor herauskristallisiert. Die Bachsche Zahlensymbolik greift Dean im Satz „Three Kings“ auf, indem er den drei Königen 3 Klarinetten, 3 Hörner, 3 Violinen, 3 Violoncelli, zwei Kontrabässe und Harfe beigesellt. Die Gestaltung ist rhythmisch differenziert, fast motivisch, wiederum in Klangflächen mündend, die den Chor tragen. Im 3.Satz „Nativity“ beginnt die Solo-Bratsche mit einer längeren Passage (den Instrumentalisten Dean verratend), die allmählich die anderen Instrumente aufnimmt. Der Chor fällt mit kurzen sich wiederholenden Passagen ein, fast in der Art einer Passacaglia. Die Besinnung wird eindrucksvoll durch flächige und doch auch cantable, sich steigernde Mehrstimmigkeit gestaltet. Im 4. Satz „Incantation“ erklingt der Chor verhalten, klanglich mehrstimmig aufgefächert mit gehaltenem Ton im Sopran, einen Hauch von Ewigkeit vermittelnd und in einer schlichten Terz endend. Man kann Brett Deans Begeisterung für die Schönheit und Homogenität des Thomanerchores voll und ganz nachvollziehen.
VI.) Krzysztof Penderecki: „Missa brevis“ für Kinderchor und Männerstimmen a cappella nach dem lateinischen Messetext, 6., 7. und 12. Januar 2013 (Wiederholung am 23. November 2013).
Krzysztof Penderecki wurde 1933 in Debica, Polen, geboren. Er hat in seinem Schaffen mehrere stilistische Wandlungen durchschritten. Eines seiner eindrucksvollsten Werke ist zweifellos seine „Lukas-Passion“ (1966 in Münster uraufgeführt), die ihm ein breites Publikum erschloss (ich durfte sie mit ihm vor Jahren in Leipzig für den MDR produzieren).
In seiner „Missa brevis“ folgt er dem lateinischen Messetext mit den Sätzen Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei, wobei Sanctus und Benedictus bereits im Jahre 2002 entstanden waren. Im Kyrie könnte man den Bezug zu einem Antiphon aus dem 4, Jahrhundert heraushören, auf den Lurther sein „Verleih uns Frieden gnädiglich“ gedichtet hat. Das „Herr, erbarme dich“ wird dabei mehrfach wiederholt, wobei sich die Gestaltung vom piano über das forte wieder bis zum piano erstreckt. Solche Wiederholungen gibt es auch im „Benedictus“ auf das Wort „venit“ (Christi Kommen). Dadurch bleibt vieles im Ohr haften wie auch im „Sanctus“ der mehrfach aufstrebende Moll-Dreiklang. Oft enden die Sätze mit einem Dur-Dreiklang, so im „Gloria“, im „Sanctus“ und im Benedictus“. Im Schlusssatz „Agnus Dei“ gestaltet Penderecki das „peccata mundi“ durch fallende Akkorde bis zum Quintschluß auf „dona nobis pacem“, als ob die Sünden der Welt durch den göttlichen Frieden aufgehoben sein könnten.
In allen Werken überzeugen die Thomaner unter ihrem Kantor Georg Christoph Biller mit klanglich ausgeglichenem, dynamisch differenziertem, engagiertem, präzisem Chorklang. Es ist kaum nachzuvollziehen, wie sie eine solch gewaltige Herausforderung neben ihren Motetten- und Gottesdienstaufgaben derart souverän bewältigen konnten. Daß sich Biller dabei auf die Solisten und das überzeugend begleitende Gewandhausorchester bis in die Solostimmen verlassen konnte, gehört in Leipzig schon zu den Normalitäten. Hervorzuheben ist auch noch einmal die überzeugende Realisierung des schwierigen Holliger-Werkes durch das „Ensemble vocal modern“ unter Christfried Brödel.
Das Programmheft des Bach-Archivs zur CD-Veröffentlichung, redaktionell von Dr. Christiane Schwertfeger betreut, ist außerordentlich informativ und auf hohem musikwissenschaftlichem Niveau. Daraus sind einige Gedanken in diese Arbeit eingeflossen. Lediglich bei der Reihenfolge der Festmusiken bzw. der Komponisten mangelt es an Konsequenz. Bei meinen Betrachtungen habe ich mich an die zeitliche Reihenfolge der Aufführungen gehalten.
Die tontechnische Qualität ist von hervorragender Balance und Durchsichtigkeit geprägt, und es ist nicht nachzuvollziehen, warum das Label „querstand“ die Namen der dafür verantwortlichen Tonmeister verschweigt, ohne deren professionelle Arbeit ein solches Ergebnis nicht möglich wäre.
Christiane Schwertfeger hebt am Schluß ihres Artikels im Begleitbuch die Rolle der neuen Musik in der Kirche hervor: „Sie befördert Austausch, Weiterdenken und die produktive Auseinandersetzung mit Fragen des Glaubens und unserer Welt.“. Wie wahr!
Leipzig, am 15. Mai 2014 Günter Neubert
Der Komponist Günter Neubert, geboren 1936 in Crimmitschau, war Meisterschüler bei Wagner-Régeny und Paul Dessau, schrieb Kammermusik, Vokalsinfonik, Ballett- und Orchestermusik.
Label: Querstand (Harmonia Mundi)
ASIN: B00EZF8KSA