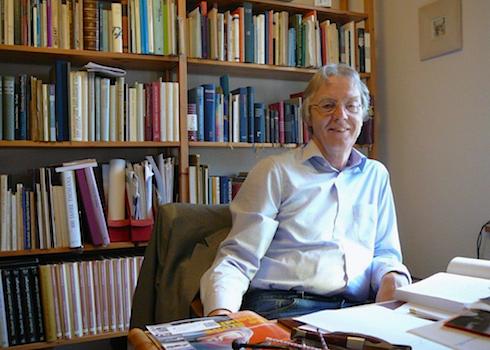Christoph Krummacher, zu DDR-Zeiten Kirchenmusiker, übernahm nach der Wende Verantwortung in verschiedenen Funktionen. Bis 2014 war er Direktor des Kirchenmusikalischen Instituts der Leipziger Musikhochschule, zwischen 1997 und 2003 deren Rektor. Seit 2007 ist er Präsident des Sächsischen Musikrats. Jetzt geht seine zweite Legislaturperiode zu Ende. Aron Koban sprach mit ihm über seine Arbeit im Musikrat und über offene Baustellen für die Zukunft.
Herr Krummacher, mit welchen Zielen sind Sie 2007 Präsident des Sächsischen Musikrats geworden?
Ich bin ein Mensch, der pragmatisch auf das reagiert, was ihm vor die Füße gelegt wird. Natürlich war klar, dass die Frage nach den Perspektiven von Kultur und insbesondere Musik in Sachsen einen Schwerpunkt meiner Arbeit bilden würde. In meiner Anfangszeit ging es konkret um die Eröffnung der Landesmusikakademie Sachsen auf Schloss Colditz. Wir haben mit der Gründung der Akademie auch die Verantwortung für den Betrieb übernommen, mit allen wirtschaftlichen Risiken.
Was hat der Musikrat in der Zeit Ihrer Präsidentschaft noch bewirken können?
An verschiedenen Stellen haben wir uns erfolgreich eingebracht, wenn ich an die eigenen Projekte, die Orchester, die Nachwuchsförderung oder die Zusammenarbeit mit den beiden Musikhochschulen denke.
In meiner ersten Amtsperiode hatten wir uns das Thema »Ganztagsangebote an Schulen« vorgenommen, das in der öffentlichen Wahrnehmung ins Hintertreffen geraten ist. Die Stellung und qualitative Kontrolle der Musik in diesem Angebot ließ zu wünschen übrig, hier ist eine bessere Steuerung nötig. Immerhin haben wir eine Bewusstseinsbildung zu dieser Problematik erreicht, eine wirkliche Zusammenarbeit, auch mit der Bildungsagentur, ist allerdings nicht zustande gekommen.
Das Generalthema der letzten vier Jahre war dann die musikalische Bildung, wo wir im Sinne der Graswurzelarbeit mit der Musik in den Kindertagesstätten angefangen haben. Hier bin ich ein bisschen optimistischer, auch wenn es sich um ein steiniges Gelände handelt, das wir beackern müssen.
Was ist daran so schwierig?
Das hat viele Gründe. Es geht zuerst einmal darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Hier sind wir vorangekommen und es haben sich Kontakte zum Kultusministerium ergeben – mit welchem Erfolg, das wird die Zukunft zeigen. Zweitens erfolgt die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern in einem diffusen Spektrum für die Altersgruppe von 0 bis 26 Jahre. Ob ich Jugendliche in einem Jugendclub an Musik heranführen will oder Vierjährige, ist ein großer Unterschied. Es gibt keine spezialisierte Ausbildung für frühkindliche Erziehung! Drittens ist der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern stark angestiegen. So sind sehr viele Ausbildungsstätten in kurzer Zeit entstanden. Das sind zwar zugelassene Einrichtungen, aber in der Praxis wird die Ausbildung aus Personalgründen nicht evaluiert.
Welche Möglichkeit sehen Sie, den Erfolg der Arbeit des Musikrates zu messen?
Der Musikrat hat bündelnde, kanalisierende, übergreifende Aufgaben und hat ein größeres »Megaphon«, um etwas in die Öffentlichkeit zu bringen. Ein Beispiel ist der Fachtag Musik. So etwas zu organisieren, könnte kein einzelner Verband leisten. Basisarbeit macht der Musikrat nicht, mit Ausnahme der von uns betriebenen Ensembles. Wir stehen in einem engen und fortwährenden Kontakt mit dem SMWK und bringen uns in aktuelle Fragen ein, z.B. in der Neubewertung des Kulturraumgesetzes oder zuletzt in die Frage der Theaterfinanzierung und Sparteneinsparung des Theaters Zwickau/Plauen.
Welche Rolle kann der Musikrat bei der Neubewertung des Kulturraumgesetzes spielen?
Wir haben uns vorgenommen, zunächst unseren eigenen Wissensstand zu optimieren und bestimmte musikspezifische Themenkreise, die das Kulturraumgesetz tangieren, zu untersuchen: die Musikschulen, die Orchester, die Kirchenmusik. Diesen Stand wollen wir in die Arbeitsgruppe, die das Kulturraumgesetz beim SMWK evaluiert, einbringen.
Wo sehen Sie Defizite der momentanen Förderpolitik?
Ein erstes Problem sehe ich darin, dass die Förderung durch das Gesetz in den einzelnen Kulturräumen sich wieder so institutionalisiert und festgeschrieben hat, dass in der Mittelvergabe wenig Spielraum besteht. Mit der Zeit haben sich möglicherweise wieder bestimmte Erbhöfe gebildet.
Zweitens gibt es einen Problemstau: Auf der einen Seite wurden die Mittel des Kulturraumgesetzes verstetigt und aufgestockt. Auf der anderen Seite fehlen flankierende strategische Überlegungen auf Landesebene, die erfolgen müssten, um den Prozess der Mittelvergabe zu begleiten. Ich denke dabei vordringlich an die Orchester und Theater. Die Entscheidung, wie viele Orchester und Theater wir im Land Sachsen brauchen, kann man nicht nur den Kulturräumen oder bestimmten Stadtparlamenten überlassen.
Im Orchester- und Theaterbereich kommt hinzu, dass es in vielen Häusern, nicht nur in Zwickau, üblich ist, die Musiker mit Haustarifverträgen zu beschäftigen. Man kann die Orchester- und Theaterleute aber nicht über 15 Jahre so abspeisen. Da schieben wir eine große Bugwelle von Defiziten vor uns her, und keiner weiß, wo die Mittel herkommen sollen.
In diesem Jahr findet wieder die Präsidiumswahl statt. Wollen Sie erneut als Präsident des Musikrats antreten?
Ich kann es mir vorstellen und bin bereit, zu kandidieren. Ich habe aber zu bedenken gegeben, dass ich mit dem Ende der kommenden Legislaturperiode, in vier Jahren, 70 sein werde. Der Musikrat muss sich überlegen, ob nicht jetzt schon Zeit für einen Generationswechsel ist.
Was hätten Sie als Präsident weiter vor? Auf welchen Gebieten sollte sich der Musikrat einbringen?
Das Thema »musikalische Bildung« hat sich noch längst nicht erledigt. Wir können zwar nicht die Ausbildungskonzepte schreiben, aber wir haben die typische Dachverbandsaufgabe, eine sehr bunte Mischung von Akteuren, sowohl in der Ausbildung von Erziehern als auch vor Ort in den Kindergärten, an einen Tisch zu bekommen, damit sie besser voneinander erfahren. Wenn bestimmte Standards installiert sind, wäre der Musikunterricht an Grundschulen das nächste dicke Brett, das wir uns vornehmen müssten.
Warum ist das Brett so dick?
Die Grundschullehrerausbildung ist insgesamt ein schwieriges Feld, erst recht im Bereich Musik. Als vor ein paar Jahren die Lehramtsausbildung auf Bachelor und Master umgestellt wurde – was den Hochschulen beträchtliche Arbeit gemacht hat – hatte dies zur Folge, dass auch die Grundschullehrer fünf Jahre Studium absolvierten. Mit der längeren Ausbildungsdauer hätten sie aber auch ein Recht auf höhere Bezahlung. Als das in der Politik bemerkt wurde, kehrte man schnell zum Staatsexamen zurück und die Grundschulausbildung wurde wieder kürzer gefasst – obwohl von allen Politikern in ihren Sonntagsreden betont wird, dass gerade die Ausbildung an Grundschulen das Wichtigste sei.
Konkret ändert sich nichts: weil man Grundschullehrer besser bezahlen müsste und weil man in Sachsen zu lange der Auffassung war, es stünde bestens um die Lehrerausbildung, und weil man sich noch dazu in den Pisa-Erfolgen sonnt.
Gibt »Pisa« den bestehenden Regelungen nicht recht?
Ich habe immer bedauert, dass es nicht so etwas wie eine Pisa-Studie für die musischen Fächer gibt. Die Messbarkeit in diesem Bereich mag eine Schwierigkeit darstellen. Für die Gesamtstruktur einer Schule spielen die musischen Angebote aber eine wichtige Rolle, so dass diese Angebote selbst mit evaluiert werden müssten. Die Bewertung wäre dann nicht inhaltlich, sondern strukturell. Wir sind ein Land mit Traditionen, es wird viel über die Bedeutung der musischen und ästhetischen Kreativität gesprochen, aber die Traditionen erhalten sich nicht von allein.